
Fraktionen sind die zentralen Organisationseinheiten im Parlament. Dies gilt für den Deutschen Bundestag, der nicht umsonst als „Fraktionenparlament“ charakterisiert wird, wie für die allermeisten Parlamente weltweit. Als Zusammenschlüsse von Abgeordneten ermöglichen Fraktionen die parlamentarische Transformation pluralistischer Interessen in gemeinwohlorientierte Entscheidungen und die effiziente Bearbeitung politischer Probleme. Wir erforschen in unserem Fraktionenprojekt unter anderem die Arbeitsweise und Stabilität dieser parlamentarischen Institutionen.
Für Fragen rund um das Thema Fraktionen wenden Sie sich an Dr. Danny Schindler unter schindler@iparl.de oder an Oliver Kannenberg unter kannenberg@iparl.de.
Das Institut für Parlamentarismusforschung untersucht die Kandidatenaufstellung für den Deutschen Bundestag über mehrere Wahlperioden hinweg. Davon, wer für parlamentarische Mandate aufgestellt wird, hängt die Leistungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie maßgeblich ab. Daher fragte das IParl in seinem Auftaktprojekt 2017, wer wen wie warum aufstellt. Vor dem Hintergrund der vorgezogenen Bundestagswahl 2025, steht die Frage nach der zeitlichen Dimension der Nominierungsprozesse im Vordergrund.
Für Fragen rund um die Kandidatenaufstellung wenden Sie sich an Anastasia Pyschny unter pyschny@iparl.de.


Koalitionsregierungen sind ein Grundmuster parlamentarischer Demokratie, das unter anderem durch neue Bündnisnotwendigkeiten bzw. -optionen auf die Probe gestellt wird. Im Blickpunkt unserer Forschung steht vor allem die Entstehung von Koalitionen: Wie werden Koalitionsverhandlungen gestaltet? Wie laufen die innerparteilichen Willensbildungsprozesse bei der Regierungsbildung ab? Und was leisten Koalitionsvereinbarungen?
Bei Interesse an unserer Forschung zu Koalitionen wenden Sie sich an Dr. Danny Schindler unter schindler@iparl.de oder an Oliver Kannenberg unter kannenberg@iparl.de.
Landesparlamente sind unverzichtbarer Bestandteil repräsentativer Demokratie in einem föderalen Staat. Im Zentrum unserer Forschung stehen grundlegende Fragen danach, auf welche spezifische Weise sie Parlamentsfunktionen erfüllen und welche Rolle sie im föderalen System Deutschlands und im Rahmen der Europäischen Union spielen. Dabei interessieren auch Vergleiche zu subnationalstaatlichen (regionalen) Parlamenten in anderen Staaten. In der bisherigen Forschung haben wir beispielsweise untersucht, wie Landesparlamente parlamentarische Kontrolle (etwa über das Fragerecht) ausüben, wie sie die Funktion der Wahl der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten erfüllt haben und welche nationalen und internationalen Kooperationen sie eingehen und unterhalten.
Für Fragen rund um Landesparlamentarismus können Sie sich an Prof. Dr. Franziska Carstensen unter carstensen@iparl.de wenden.


Parlamentarismusforschung findet nicht nur in Deutschland statt. Wir versammeln eine Reihe von Länderexpertinnen und -experten, die sich in ihrer Forschung mit den Regierungssystemen und Parlamenten anderer Länder befassen und darin Expertise vorweisen können.
Für Fragen rund um das politische System Frankreichs stehen Ihnen Dr. Calixte Bloquet unter bloquet@iparl.de und Anastasia Pyschny (pyschny@iparl.de) zur Verfügung.
Alexander Kühne befasst sich mit dem US-amerikanischen Regierungssystem und ist unter kuehne@iparl.de Ihr Ansprechpartner zu allen Fragen rund um die USA.
Die Länder des Westbalkan befinden sich in der demokratischen Transitionsphase. Oliver Kannenberg forscht zur Entwicklung des Parlamentarismus in diesen Staaten und ist unter kannenberg@iparl.de erreichbar.
Zu den Staaten Ostafrikas forscht Dr. Danny Schindler – erreichbar unter schindler@iparl.de.
Parlamentarische Kontrolle ist eine der wesentlichen Funktionen von Parlamenten. Ihre Form ist sehr vielgestaltig, sie kann von einzelnen Abgeordneten, Ausschüssen, Fraktionen oder vom gesamten Parlament übernommen werden. Je nach Parlament stehen dabei unterschiedliche Instrumente zur Verfügung: Sie reichen von den Fragerechten über Untersuchungsausschüsse bis hin zu Formaten im Plenum wie den mündlichen Fragen und Aktuellen Stunden. Im Zentrum unserer Forschung steht die Frage, wie Parlamente diese wichtige Funktion erfüllen, welche Instrumente sie nutzen und testen und welche besonders gut geeignet sind. In der bisherigen Forschung haben wir beispielsweise vergleichend die Fragerechte im Bundestag und in den Landesparlamenten sowie in der französischen Nationalversammlung untersucht; ebenso haben wir uns mit der Kontrolltätigkeit während der Corona-Pandemie beschäftigt.
Für Fragen zur Kontrolltätigkeit von Parlamenten, wenden Sie sich an Prof. Dr. Franziska Carstensen (carstensen@iparl.de) oder an Anastasia Pyschny (pyschny@iparl.de).


Repräsentation – im Sinne Ernst Fraenkels verstanden als Recht und Pflicht zur verbindlichen Entscheidung für das Gemeinwesen – ist die Kernaufgabe demokratischer Parlamente. Sie verdeutlicht zugleich den zentralen Stellenwert, den ein Parlament als Legitimationsinstanz im politischen System einnimmt. Besondere Bedeutung erlangt dieses zeitlose Forschungsthema angesichts vielfältiger nationaler und globaler Herausforderungen, mit denen Parlamentarierinnen und Parlamentarier und die Gesellschaft als Ganzes gegenwärtig konfrontiert sind.
Im Rahmen des COMPARE-Projektes erforschen Alexander Kühne (kuehne@iparl.de) und Christian Ignorek (ignorek@iparl.de) das Repräsentationsverständnis von Abgeordneten.
Durch Wahlen bestimmen die Wählerinnen und Wähler, wer sie in den Parlamenten vertritt. Nach welchen Regeln Wahlen ablaufen, wie aus Stimmen Mandate werden und wer die Durchführung organisiert, sind daher für die Qualität demokratischer Repräsentation essenziell. Wir begleiten den Reformprozess rund um das Bundestagswahlrecht mit unserer Expertise und forschen darüber hinaus auch zu Fragen der Wahlorganisation und dem damit einhergehenden Vertrauen in Wahlen.
Für Fragen rund um Wahlen und Wahlrecht wenden Sie sich an Daniel Hellmann unter hellmann@iparl.de.
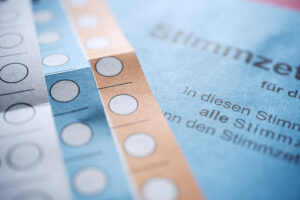

Ungefähr 40 Prozent der Parlamente weltweit sind bikameral. Zweite Kammern finden sich auf jedem Kontinent, in parlamentarischen wie präsidentiellen Regierungssystemen, in föderalen und unitarischen Staaten, in Demokratien und Autokratien: Beispiele sind das britische House of Lords, der französische Senat, der deutsche Bundesrat, die Senate in Lateinamerika und in den USA. Die Frage, was diese Zweiten Kammern für die Systeme, deren Bestandteil sie sind, leisten, wird mitunter debattiert, manchmal wird auch ihre Existenz in Frage gestellt. Trotz der Bedeutung dieser Debatten stehen Zweite Kammern bisher selten im Zentrum von politikwissenschaftlicher Forschung. Das IParl will mit einem Forschungsprojekt über Repräsentation in europäischen Zweiten Kammern zu dieser Diskussion beitragen.
Prof. Dr. Franziska Carstensen (carstensen@iparl.de) und Dr. Calixte Bloquet (bloquet@iparl.de) erforschen Zweite Kammern im Rahmen des second chambers Projektes.
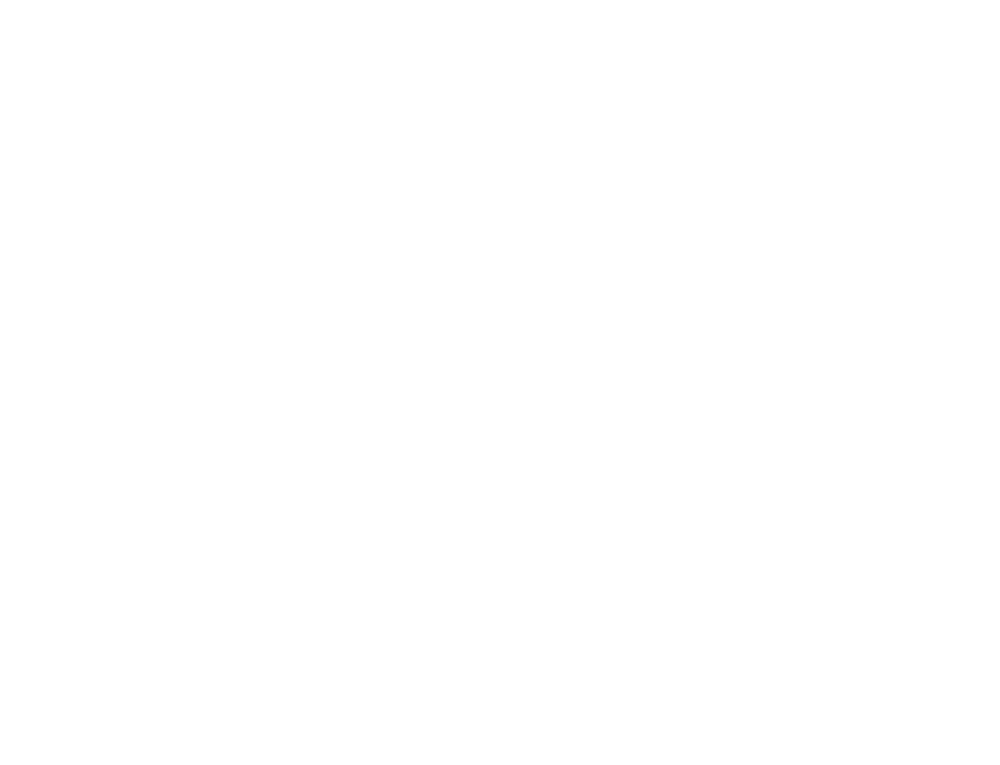
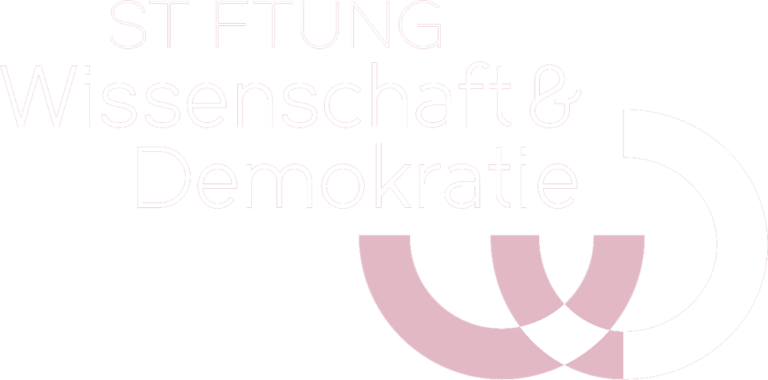
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.