Das IParl untersucht in seinem ersten Forschungsprojekt die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 in den Bundestagsparteien CDU, CSU, SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD.
Mithilfe von quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Politikforschung soll herausgefunden werden, wie die Nominierungsverfahren gestaltet sind, wer kandidiert, wer über die Erfolgschance einer Kandidatur entscheidet, welche Kriterien bei den Nominierungen eine Rolle spielen, ob und wie sich die Rekrutierungen zwischen und innerhalb der Parteien unterscheiden.
Weitere Informationen zum Studiendesign sowie ausführliche Methodenberichte finden Sie hier.
von Daniel Hellmann und Benjamin Höhne
Satzungen bestimmen die internen Spielregeln einer Partei. Bei den Kandidatenaufstellungen geben sie Aufschluss darüber, wer dazu befugt ist, Auswahlentscheidungen zu treffen, wer kandidieren darf und welche Regeln bei den innerparteilichen Wahlen gelten. Untersuchungsgegenstände sind die Satzungen und Statuten der Bundestagsparteien CDU, CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD zur Bundestagswahl 2017. Aufgrund des im internationalen Vergleich eng gesetzten rechtlichen Rahmens in Deutschland, sind viele Ähnlichkeiten zwischen den Parteien auszumachen, aber auch Unterschiede, die unter anderem auf unterschiedliche innerparteiliche Partizipationskulturen hinweisen. Differenzen wurden vor allem im Hinblick auf den Kreis der Auswahlberechtigten ausgemacht, der bei den kleineren Parteien tendenziell inklusiver ausfällt als bei den größeren. Am geringsten ist die formale Ausgestaltungsdichte bei der AfD, die aufgrund ihres jungen Alters bisher wenig Anlass zur Institutionalisierung formaler Regeln fand. In längsschnittanalytischer Perspektive ließ sich durch einen Vergleich mit den Satzungen zur Bundestagswahl 2002 beachtliche Kontinuität und nur wenig Wandel feststellen.
von Danny Schindler
Zu den innerparteilichen Auswahlprozessen, die der Listenaufstellung für den Deutschen Bundestag vorangehen, liegen bisher kaum systematische Erkenntnisse vor. Sie sind allerdings von großer Bedeutung, wenn man das Geschehen auf den wahlrechtlich vorgesehenen Nominierungskonferenzen treffend beurteilen und erklären will. Vor diesem Hintergrund werden die der Listenaufstellung für die 19. Wahlperiode vorgelagerten Verfahren von CDU und SPD untersucht. Auf der Basis von Beobachtungs- und Befragungsdaten zeigt sich, dass in beiden Parteien vielstufige und vielgestaltige Selektionsmechanismen existieren, die die späteren Nominierungsentscheidungen stark vorstrukturieren und im Einzelfall auch faktisch vorwegnehmen. Den Landesparteivorständen kommt in sehr unterschiedlichem Maße (Vor-)Selektionsmacht zu und teilweise ist auch von einer Machtüberschätzung durch die auswählenden Parteimitglieder auszugehen. Die Aufstellungsverfahren erfordern insgesamt Repräsentationsleistungen auf verschiedenen Ebenen und können auch als Ausweis innerparteilicher Demokratie angesehen werden. Nachgedacht werden sollte allerdings über eine stärkere satzungsrechtliche Normierung der Vorauswahlprozeduren. Deren verbreitete Informalität geht zu Lasten der Nachvollziehbarkeit parteipolitischer Willensbildung, auch unter Parteimitgliedern und möglichen Kandidaturinteressenten.
von Daniel Hellmann
Die Ochsentour, also der mühsame parteiinterne Aufstieg hin zu politischen Entscheidungspositionen, ist im allgemeinen Sprachgebrauch meist negativ konnotiert. Trotz dieser negativen Bewertung ist bislang unklar, was dieser Prozess der innerparteilichen Bewährung genau ist und wie man die Ochsentour sowohl vom Sprachbild als auch vom Inhalt her definieren könnte. Eine deskriptive Bestandsaufnahme unter Rückgriff auf Befragungsdaten des IParl zeigt, dass der Erfolg eines Bewerbers von deutlich mehr als der für die Ochsentour symptomatischen Parteimitgliedschaftsdauer abhängt. Diese dient, wie die meisten anderen untersuchten Faktoren, eher dazu, Vertrauen aufzubauen und sich gegenüber der eigenen Parteibasis zu beweisen. Insgesamt zeichnen die Daten das Bild eines flexiblen, vielseitig engagierten und der Parteibasis bekannten Kandidaten. Das Sprachbild der Tour des Ochsen passt damit nicht zu dem, was die Kandidaturbewerber tatsächlich leisten.
von Malte Cordes und Daniel Hellmann
Vor der Wahl suchen die Parteimitglieder diejenigen aus, die als Kandidaten antreten. Deren Entscheidungen hängen davon ab, wie sie sich einen ‚idealen Kandidaten‘ vorstellen. Auf Grundlage einer Befragung von auswahlberechtigten Parteimitgliedern zur Bundestagswahl 2017 durch das Institut für Parlamentarismusforschung (IParl) lassen sich diese Präferenzen untersuchen. Es zeigt sich, dass es zwar kein einheitliches Idealbild gibt, aber auch keine distinkt voneinander verschiedenen Gruppen. Unterschiede treten weniger im Vergleich von Wahlkreis- und Landesebene auf, sondern eher im Parteienvergleich. Auch die Bewerber selbst nehmen die Ansprüche der Auswählenden teilweise anders war. Vermutlich haben diejenigen, die diese komplexen Ansprüche besser antizipieren können, auch bessere Chancen im parteiinternen Nominierungsprozess.
von Oliver Kannenberg
Aufstieg und Etablierung der AfD haben die deutsche Parteienlandschaft in den vergangenen Jahren nachhaltig verändert und die etablierten Parteien herausgefordert. Mögliche Effekte auf die Rekrutierungsfunktion der Parteien, der sie mit der Kandidatenaufstellung zu Wahlen nachkommen, wurden bisher nicht untersucht. Im Rahmen leitfadengestützter Interviews wurden Parteimitglieder auf den Aufstellungsversammlungen nach einem möglichen Einfluss der rechtspopulistischen Partei auf die Kandidatenaufstellung befragt. Es zeigen sich starke Beharrungskräfte in den etablierten Parteien, sowohl den Modus der Aufstellung betreffend als auch die dazu herangezogenen Auswahlkriterien. Die Kandidaten zur Bundestagswahl 2017 wurden trotz des veränderten Parteienwettbewerbs weit überwiegend nach innerparteilichen Kriterien ausgewählt. Der Fokus lag eindeutig auf der langfristigen Bewährung innerhalb der Partei. Dennoch sind erste Anzeichen für eine zukünftig stärkere Gewichtung der wählerbezogenen Selektionskriterien erkennbar. Dazu beitragen könnten vor allem die sinkenden Mitgliederzahlen, ein veränderter Wettbewerb um Direktmandate und eine verstärkte parteiinterne Polarisierung.
von Benjamin Höhne
Die parlamentarische Präsenz von Frauen steht seit einiger Zeit verstärkt im Fokus öffentlicher Debatten. Diesen mangelt es weniger an theoretischen Argumenten, sondern eher an empirischen Erkenntnissen. Wie der „Gender Gap“ zwischen der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und der Bevölkerung zu erklären ist, kann anhand der Kandidatenaufstellungen aller sieben Bundestagsparteien zur Bundestagswahl 2017 analysiert werden. Bei den ermittelten Auswahlpräferenzen zeigen teils deutliche Mehrheiten fast aller Parteien (bis auf AfD) Sensibilität für eine ausgleichende Geschlechterpräsenz. In drei konsekutiven Schritten werden die Rekrutierungsetappen beginnend beim Übergang von der Gesellschaft zur Partei und endend bei der Wahl der Bundestagsabgeordneten durchleuchtet. Die Probleme der Minderpräsenz von Frauen setzen früh ein, das heißt bereits bei der Parteimitgliedschaft. Signifikante Differenzen zwischen den Geschlechtern beim innerparteilichen Engagement finden sich dagegen kaum. Bei den Nominierungsentscheidungen zeigt sich häufiger eine positive Diskriminierung von Frauen – vor allem auf den Landeslisten – , als eine negative – vor allem in den Wahlkreisen.
von Suzanne S. Schüttemeyer und Anastasia Pyschny
Die im Bundestag vertretenen Parteien zählen circa 300.000 aktive Mitglieder, aus denen alle Mandatsträger, vom Gemeinderat bis zum Europäischen Parlament, rekrutiert werden. Durch den anhaltenden Mitgliederschwund der Parteien verkleinert sich zunehmend auch der Pool, aus dem die Parteien ihr politisches Personal schöpfen. Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklung und der überragenden Bedeutung der Rekrutierungsfunktion der Parteien für die Funktionsweise und den Bestand des politischen Systems wurde die Kandidatenaufstellung zum Deutschen Bundestag seit fünf Jahrzehnten nicht umfassend systematisch untersucht. Das Institut für Parlamentarismusforschung (IParl) hat sich daher vor der Bundestagswahl 2017 dieser Forschungslücke mit der Frage gewidmet, wer wen wie und warum für eine Bundestagskandidatur im Wahlkreis und auf der Landesliste auswählt und aus welchen Gründen beziehungsweise anhand welcher Kriterien Parteimitglieder ihre Entscheidungen treffen. Die Erhebungsdaten unterfüttern den Sorgenzustand: Nicht nur die personellen, sondern auch die partizipatorischen Grundlagen demokratischer Ordnung schwinden im Zeitverlauf. Obwohl die Parteien im Allgemeinen häufiger Mitgliederversammlungen durchführen, ist die Beteiligung der die Bundestagskandidaten auswählenden Parteimitglieder von CDU, CSU und SPD innerhalb von 15 Jahren um 46 Prozent gesunken. Inklusivere Verfahren stellen demnach kein Allheilmittel dar. Vielmehr müssen die Parteien auch darauf achten, dass vorhandene Beteiligungsangebote umfassend genutzt werden.
von Danny Schindler und Benjamin Höhne
While there is plenty of research investigating the methods for choosing parliamentary candidates and their consequences, only a few studies have explored the preferences of party members for various selection modes. This article focuses on those party members actively involved in candidate nominations, separated in leaders, delegates and rank-and-file. As it is well known, party activities are pivotal when it comes to procedural reforms. Our data base is a representative survey in the run-up of the 2017 national election within all current Bundestag parties that includes selections at the distict level and for party lists. The data show that there is very limited reform support for open primaries. Moreover, party members frequently opt for the procedures with which they are long familiar. Evidence for assuptions that party elites prefer inclusive procedures to circumvent mid-level activists could not be found. Looking at context factors, general meetings are more strongly supported in competitive settings. Regarding list selections, a strong membership base and a large territorial size of a federal state lead to favoring the delegate principle which points to organizational and practical considerations.
von Benjamin Höhne
Does the demand for more direct democracy by populist parties have any implications for their internal decision-making? To answer this question, a novel large-scale research project analyses the 2017 candidate selection of all Bundestag parties, including the populist Alternative for Germany. Some 1,334 individual nominations of seven parties are compared using quantitative indicators along three dimensions of intra-party democracy (IPD): competition between aspirants for candidacy, inclusion of members and nomination-related communication. It shows that the AfD is living up to its promise of practising grassroots democracy: in all results it ranks at the top by a wide margin. A new populist organizational model seems to have emerged following neither the classic hierarchical and leader-oriented mode of many other European right-wing populist parties nor the delegate assembly mode typical of German parties. Our further development of IPD concepts, newly elaborated measuring methods and surprising empirical evidence improve the understanding of democratic decision-making in populist parties.
von Benjamin Höhne
Das politische Personalmanagement für Schaltstellen der repräsentativen Demokratie findet in den politischen Parteien statt. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland unterbreiten sie den Wählerinnen und Wählern bei den turnusgemäß alle vier bzw. fünf Jahre stattfindenden Wahlen in den Kommunen, den Bundesländern, dem Bund und der Europäischen Union ein personelles Angebot.
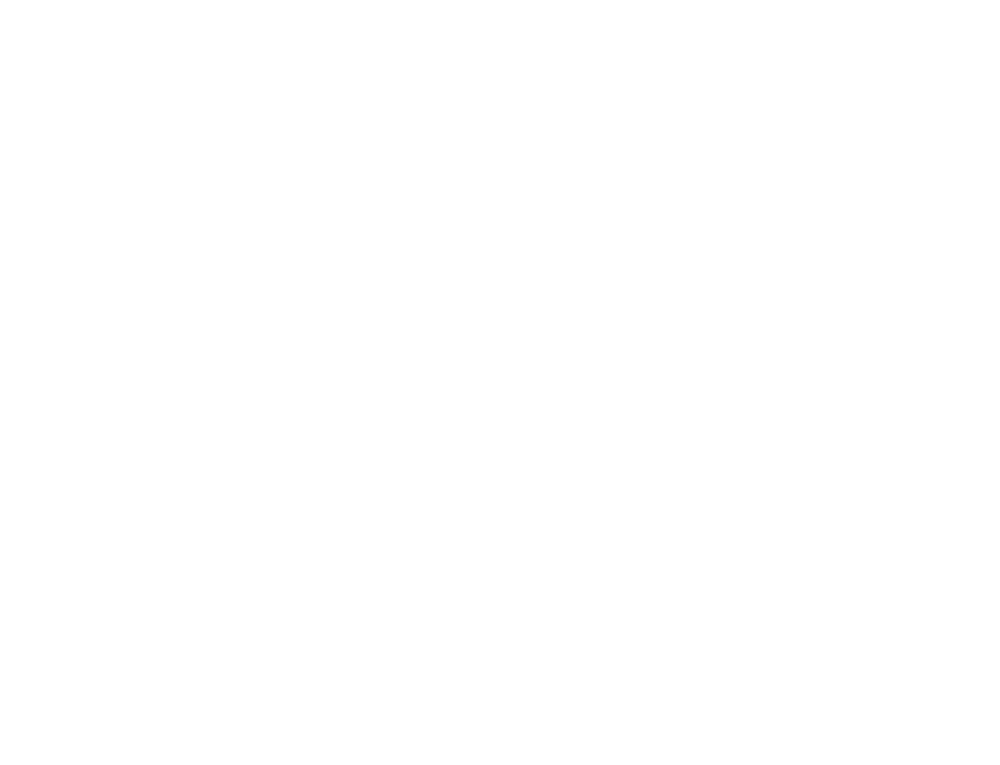
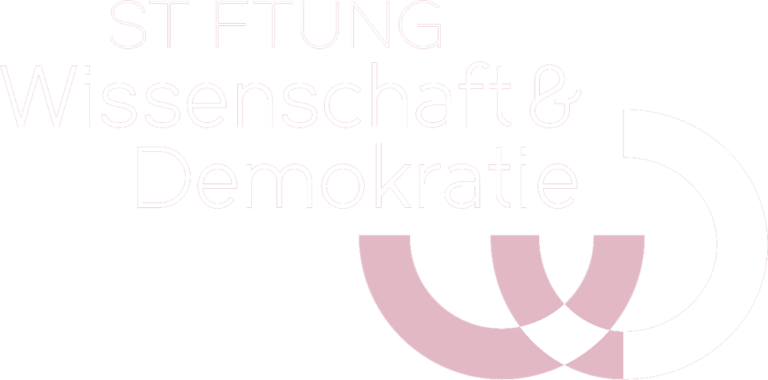
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.