DOI: 10.36206/BP2020.01
Das Coronavirus SARS-CoV-2 wurde im Dezember 2019 das erste Mal im chinesischen Wuhan nachgewiesen und hat sich von dort in rasantem Tempo weltweit ausgebreitet. In Deutschland trat das Virus nachweislich erstmals Ende Januar 2020 im Landkreis Starnberg in Bayern auf.[1] Dies war der Startschuss für eine ganze Reihe von Maßnahmen der Bundesregierung, die auch in Koordination mit den Landesregierungen getroffen wurden.[2] Die wichtigsten Vorkehrungen der ersten fünf Monate waren[3]:
Die Maßnahmen traten in der Regel mit sofortiger Wirkung in Kraft oder galten – wie für die Verordnung zum Kurzarbeitergeld – rückwirkend. Die Schnelligkeit, mit der politische Entscheidungen getroffen werden mussten, kann als Zuspitzung eines problematischen Trends verstanden werden, der „politische Planung“ immer öfter durch „flexibel-kurzfristiges Anpassungsverhalten“ ersetzt.[4] Viele Regierungen schienen mit dem Corona-Krisenmanagement überfordert gewesen zu sein, was innerhalb der Europäischen Union vor allem für Italien und
Spanien konstatiert wurde.[5] Das Handling der Bundesregierung wurde aufgrund der vergleichsweise niedrigen Sterblichkeitsrate und hohen Testkapazitäten in der nationalen[6] und internationalen[7] Presseberichterstattung viel gelobt. Des Öfteren wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel anerkennend als „Krisenmanagerin“[8] betitelt. Beobachter des tagespolitischen Geschehens waren sich einig: Es schlägt die Stunde der Exekutive.
Je länger diese „Stunde“ jedoch andauerte, desto mehr sank die – generell hohe − öffentliche Akzeptanz für die Regierungsmaßnahmen: Zeigten sich im März dieses Jahres noch drei Viertel der wahlberechtigten Deutschen mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden, traf dies im April auf 72 Prozent, im Mai auf 67 Prozent und im Juni noch auf 62 Prozent zu.[9] Es ist naheliegend, dass die zunehmende Skepsis vor allem mit der Tragweite der Maßnahmen zusammenhing: Kontakt- und Versammlungsverbote, Ausgangsbeschränkungen, Abstandsgebote, Einreisebeschränkungen, Schließungen von Einrichtungen des öffentlichen Lebens wie Schulen, Kitas, Restaurants und Geschäften sowie Sanktionen bei Verstößen ließen Zweifel daran aufkommen, wie stark der Staat in der Krise sein darf und sein soll.
Zwar stimmt, dass in vielen europäischen Ländern strengere Ausgangsbeschränkungen als in Deutschland herrschten wie zum Beispiel in Italien, Spanien und Frankreich. Hier durfte die Bevölkerung landesweit über mehrere Wochen nur mit Passierschein aus dem Haus. Richtig ist jedoch auch, dass viele der in Deutschland getroffenen Regierungsmaßnahmen massiv in das öffentliche Leben sowie in die wirtschaftliche und individuelle Freiheit eines jeden Bürgers eingriffen. Grundrechte wurden − und werden − durch die Schutzmaßnahmen eingeschränkt, wobei rechtlich umstritten ist, wie weit diese Einschränkungen gehen dürfen. Die Kontrolle der von der Regierung beschlossenen Maßnahmen ist einer der wichtigsten Aufgaben des Parlamentes. Der Ausbruch des Coronavirus ging jedoch auch am Deutschen Bundestag nicht spurlos vorüber.
Der Bundestag ist mit seinen 709 Mitgliedern das zweitgrößte Parlament der Welt. In Zeiten der Corona-Pandemie stellt eine Zusammenkunft dieser Größenordnung ein hohes Infektionsrisiko dar. Vor allem, weil das Durchschnittsalter der Abgeordneten mit knapp 50 Jahren an einer Grenze liegt, ab der aus medizinischer Sicht verstärkt schwerere Krankheitsverläufe auftreten können.[10]
Um Ansteckungsrisiken zu vermeiden und dennoch die Handlungsfähigkeit des Bundestages zu gewährleisten, stimmten am 25. März 2020 – bei drei Enthaltungen − alle Abgeordneten für die Änderung der Geschäftsordnung (GOBT). Nach dem neu eingefügten § 126a, ist der Bundestag „beschlussfähig, wenn mehr als ein Viertel der Mitglieder im Sitzungssaal anwesend ist.“[11] Diese Regelung gilt auch für Ausschusssitzungen, bei denen zudem die Möglichkeit besteht, für Beschlussfassungen elektronische Kommunikationsmittel zu nutzen. Die Änderungen wurden abweichend zu den §§ 45 und 67 GOBT getroffen, nach denen für Beschlüsse im Plenum und in den Ausschüssen mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein müssen. Der neue Paragraf kann jederzeit vom Bundestag aufgehoben wer- den und läuft am 31. Dezember 2020 aus.[12]
Die Anpassung der GOBT war die formelle, aber nicht einzige Änderung der Parlamentsarbeit: Eine neue Sitzordnung auf Abstand, Ausschuss- und Fraktionssitzungen per Video- oder Telefonkonferenzen, gekürzte Tagesordnungen und Sitzungswochen sowie ein verändertes Verfahren für namentliche Abstimmungen bestimmen den derzeitigen Parlamentsalltag der Abgeordneten. Da über die Maßnahmen interfraktionelle Einigkeit vorherrschte, wurden sie auch von Seiten der Opposition positiv bewertet. So versicherte der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) dem ZDF: „Der Bundestag funktioniert. Wir kontrollieren die Regierung und wir werden das, was sie als Regierung vorlegt, auch nicht einfach unkommentiert durchwinken.“[13]
Zu klären bleibt, wie und in welchem Umfang eine Kommentierung der Regierungsvorlagen und -maßnahmen seitens der Oppositionsfraktionen erfolgte. Im Verlauf der Corona-Pandemie kam vermehrt die Kritik auf, dass die Opposition von ihren Kontrollmöglichkeiten zu wenig Gebrauch mache: „Dem fast alternativlos scheinenden Kurs von Bundesregierung und Kanzlerin hat die Opposition kaum etwas entgegenzusetzen“, hieß es am 22. April 2020 unter der anklagenden Dachzeile „Corona-Krise lähmt Opposition“ auf tagesschau.de.[14] Auch Politikwissenschaftler Stephan Bröchler kritisierte das Management der Opposition und warnte vor den Folgen einer „Superkonsensdemokratie“, in der die Opposition mehr „Mitregent“ als „Dissident“ wäre.[15] Diese Aussagen stellen die Handlungsfähigkeit des Parlamentes in Frage, da die Kontrollfunktion neben der Gesetzgebungsfunktion zu den genuinen Parlamentsaufgaben gehört.
Gemäß der Logik des „Neuen Dualismus“, nach dem sich Regierungsmehrheit und parlamentarische Opposition als Antipoden gegenüberstehen, wird die Kontrollfunktion von den Abgeordneten der Regierungsfraktionen anders wahrgenommen als von Mitgliedern der Oppositionsfraktionen. Erstere verfolgen u.a. das Ziel, die Regierung im Amt zu halten und ihre Wiederwahl zu gewährleisten. Dies hindert sie jedoch nicht daran, Kontrolle auszuüben.[16] Zu diesem Zweck nutzen sie in erster Linie informelle Kontrollkanäle, zum Beispiel im Zuge der Fraktionsarbeitskreise, bei denen häufig auch Minister zugegen sind[17] oder gelegentlich auch von Ausschusssitzungen[18].
Demgegenüber besteht die Motivation der Oppositionsfraktionen eher darin, mithilfe der formalen Frage- und Informationsrechte Kritik an der Regierung zu üben, um kompetenter aufzutreten und sich als Regierungsalternative zu profilieren. Gemäß §§ 100ff. der GOBT gehören zu den formalen Kontrollrechten:
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass nicht nur die Koalitionsfraktionen, sondern auch die parlamentarische Opposition informelle Kontrolle ausüben kann.[19] Es erscheint naheliegend, dass die Oppositionsfraktionen informelle Kontrollkanäle auch in Corona-Zeiten nutzten. Politikwissenschaftlerin Suzanne S. Schüttemeyer merkte diesbezüglich an: „Die Opposition ist von der Kanzlerin und von den Ministerien über geplante Gesetzesvorhaben und Entscheidungen informiert worden und konnte mitsprechen.“[20] Auch Bundestagsdirektor a.D. Wolfgang Zeh stellte fest, dass die Regierung nach Ausbruch des Coronavirus zweifelsohne nicht nur Gespräche mit den Koalitions-, sondern auch mit den Oppositionsfraktionen führte: „Wie mit den Landesregierungen finden informelle Vorklärungen selbstverständlich auch mit den Fraktionen des Bundestages und zwischen ihnen statt. Politisch kann es sich keine Regierung erlauben, ohne Rückkopplung mit den parlamentarischen Kräften zu operieren.“[21] Im Gegensatz zu den informalen Kontrolltätigkeit von Abgeordneten der Regierungsfraktionen[22] und Oppositionsfraktionen, kann die Nutzung formaler Kontrollinstrumente durch die parlamentarische Opposition statistisch erhoben werden. Gerade in Corona-Zeiten scheint ein genauer Blick auf diese Nutzung vor dem Hintergrund ihrer kritischen Beurteilung über- fällig. Aus diesem Grund wird die Verwendung der in den letzten Wahlperioden zumeist bedienten oppositionellen Kontrollrechte, d.h. Kleine Anfragen sowie Schriftliche und Mündliche Fragen, im Folgenden für die ersten fünf Monate nach Ausbruch des Coronavirus bis zur parlamentarischen Sommerpause in den Blick genommen.[23]
Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte unterteilt diesen Zeitraum in zwei Phasen: „In der ersten Phase der Pandemie ging es logischerweise um Katastrophenschutz. Da stand die Regierung anders als die Opposition im Fokus – und alle waren sich einig.“ Die zweite Phase betitelt Korte als „Phase der Öffnungspolitik“, in der verstärkt unterschiedliche Interessen vor- herrschen und die sich seines Erachtens zu einer „Sternstunde der Opposition“ entwickeln könnte.[24] Um beide Phasen vergleichen zu können, werden sie nacheinander betrachtet.
Im Februar 2020 war die Fallzahl der mit Covid-19 Infizierten in Deutschland niedrig, bevor sie Mitte März rasant anstieg und erst Ende April wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte.[25] In diesem Zeitraum haben die Oppositionsfraktionen Kleine Anfragen, Schriftliche und Mündliche Fragen seltener genutzt als im Vorjahreszeitraum (s. Tabelle 1). Allerdings ist der Rückgang moderat und muss im Vergleich zur durchschnittlichen monatlichen Nutzung von Kontrollinstrumenten in der laufenden Wahlperiode bis zum Ausbruch des Virus relativiert werden.
|
Kontrollinstrument |
Februar 2020 |
März 2020 |
April 2020 |
Ø Nutzung pro Monat |
Ø Nutzung pro Monat Vorjahreszeitraum Februar bis April 2019 | Ø Nutzung pro Monat
19. WP1 |
| Kleine Anfragen | 173 | 407 | 148 | 243 | 289 | 250 |
| Schriftliche Fragen | 513 | 428 | 523 | 488 | 519 | 481 |
| Mündliche Fragen2 | 125 | 71 | 151 | 116 | 148 | 126 |
Quelle: Dokumentations- und Informationssystem (DIP) für parlamentarische Vorgänge
1 Berechnung des Durchschnittswertes ab dem Folgemonat der Regierungsbildung April 2018 bis Ende Januar 2020, exklusive der parlamentarischen Sommerpausen im Juli und August 2018 sowie 2019.
2 Umfassen alle im Plenum gestellten Fragen an die Bundesregierung.
Am deutlichsten tritt der Rückgang im Nutzungsverhalten Mündlicher Fragen hervor. Zwischen Februar und April 2020 wurden im Plenum pro Monat durchschnittlich 116 Fragen an die Regierung gestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit durchschnittlich 148 Mündlichen Fragen im Monat, stellt dies einen Rückgang von 27,6 Prozent dar und zum durch- schnittlichen Monatsgebrauch in der laufenden Wahlperiode mit 126 Mündlichen Fragen einen Rückgang von 7,9 Prozent. Da Mündliche Fragen im Plenum gestellt werden und demnach die physische Präsenz von Abgeordneten und Regierenden voraussetzt, liegt die Vermutung nahe, dass ihre Anwendung aufgrund der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 und den daher durch das Parlament getroffenen Schutzmaßnahmen häufiger vermieden wurde. Britta Haßelmann, erste Parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, hob die permanente Gratwanderung hervor: „Hier in Berlin versuchen wir das Parlament arbeitsfähig zu halten und müssen immer abwägen zwischen der Tagung, der Beratung, der Entscheidung und auch der Kontrolle der Regierung und dem Infektionsschutz.“[26]
Geringfügiger fallen die Unterschiede im Vergleich Kleiner Anfragen und Schriftlicher Fragen aus. In der ersten Pandemie-Phase wurden pro Monat durchschnittlich 243 Kleine Anfragen gestellt. Dies sind knapp 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (289) und 2,8 Prozent weniger als im monatlichen Durchschnitt der Wahlperiode bis zum Ausbruch des Virus (250). Schriftliche Anfragen wurden nur im Vorjahresvergleich seltener genutzt (488 zu 519 im Monatsdurchschnitt). Im Vergleich zum durchschnittlichen Gebrauch pro Monat der Wahlperiode vor Ausbruch des Coronavirus stieg die Nutzung Schriftlicher Fragen mit 488 zu 481 leicht an.
Im Gegensatz zu den Mündlichen und Schriftlichen Fragen[27] müssen Kleine Anfragen so- wohl schriftlich gestellt, als auch schriftlich beantwortet werden und können daher als home-office-freundliches Verfahren eingestuft werden. Zwar bedürfen Kleine Anfragen immer den Beschluss von mindestens fünf Prozent aller Abgeordneten oder einer Fraktion, wofür vor- bereitende Absprachen nötig sind. Mittels Telefon- und Videokonferenzen kann diese Vorbereitung allerdings auch aus dem Home-office erfolgen. Vor diesem Hintergrund könnte kritisiert werden, dass dieses Kontrollinstrument nicht noch stärker genutzt wurde, so dass der vergleichsweise starke Rückgang Mündlicher Fragen hätte kompensiert werden können.
Dieser Einwand ist nicht gänzlich zu entkräften, aber zu entschärfen. Die detaillierte Gegenüberstellung der Nutzung von Mündlichen Fragen und Kleinen Anfragen verrät, dass es Kompensationstendenzen gab (s. Abbildung 1). Demnach wurden in den Monaten Februar und März weniger Mündliche Fragen als im Vorjahreszeitraum gestellt, dafür aber mehr Kleine Anfragen als im Vorjahr. Im Lockdown-Monat März reduzierte sich beispielsweise die Nutzung Mündlicher Fragen im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches (von 241 im März 2019 auf 71 im März 2020), die Kleinen Anfragen stiegen hingegen von einem ohnehin stark überdurchschnittlichen Wert von 349 Kleine Anfragen im März 201928 um weitere zehn Prozent auf 407 Kleine Anfragen im März 2020 an. Dies ist die höchste Anzahl monatlich gestellter Kleiner Anfragen innerhalb der gesamten 19. Wahlperiode.
Quelle: Dokumentations- und Informationssystem (DIP) für parlamentarische Vorgänge.
Erst im April fällt die Nutzung Kleiner Anfragen hinter den Vorjahreswert zurück, allerdings drastisch um mehr als die Hälfte (auf 148 zu 349 im Vorjahr). Zeitgleich stieg aber auch die Nutzung Mündlicher Fragen um mehr als das Doppelte an (von 67 im April 2019 auf 151 im April 2020). Warum es zu diesem Umschwung kam, ist schwer zu sagen. Er zeigt in jedem Fall, dass bereits im April schon wieder eifrig im Bundestag diskutiert wurde. Darüber hinaus weisen die gegenläufigen Trends in der Nutzung Mündlicher Fragen und Kleiner Anfragen darauf hin, dass es keinen Monat gab, in dem Fragrechte im Vorjahresvergleich insgesamt unterdurchschnittlich genutzt wurden. Vielmehr bediente die Opposition innerhalb eines Monats ein Frageinstrument stärker, während sie von einem anderen Kontrollrecht vergleichsweise weniger Gebrauch machte. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass Mündliche Fragen und Kleine Anfragen in dieser ersten Pandemie-Phase insgesamt etwas seltener genutzt wurden. Jedoch findet dieser Rückgang innerhalb dieser Periode nicht zeitgleich statt, so dass zu keinem Zeitpunkt ein starker Rückgang in der Gesamtnutzung der ausgewiesenen Kontrollrechte durch die Opposition beobachtet werden kann.
Auf einer Pressekonferenz zu den Corona-Regeln am 6. Mai 2020 sagte Bundeskanzlerin Merkel: „Die erste Welle der weltweiten Krankheit ist vorbei.“[29] Ab diesem Zeitpunkt standen nicht mehr Verbote und Beschränkungen im Vordergrund, sondern die Frage, ob, wann und wie die zuvor getroffenen Bestimmungen wieder gelockert bzw. aufgehoben werden können. Da diese Phase noch anhält, kann an dieser Stelle nur ihr Beginn bis zur parlamentarischen Sommerpause, d.h. die Monate Mai und Juni, in den Blick genommen werden.
Für diesen Zeitraum lässt sich durchschnittlich eine stärkere Nutzung von formalen Kontrollrechten beobachten (s. Tabelle 2). Kleine Anfragen sowie Schriftliche und Mündliche Fragen wurden nicht nur öfter genutzt als im Vorjahreszeitraum (1) und als im monatlichen Durschnitt der 19. Wahlperiode bis zum Ausbruch des Virus (2), sondern auch öfter als in der ersten Pandemie-Phase (vgl. Tabelle 2 und Tabelle 1). Doch die Unterschiede sind moderat. Genau wie für die erste Phase insgesamt ein leichter Rückgang der Nutzung formaler Kontrollins- trumente zu beobachten ist, kann in der zweiten Pandemie-Phase insgesamt ein mäßiger Anstieg im Nutzungsverhalten festgestellt werden. Im Vergleich beider Monate tritt dieser Anstieg deutlicher im Juni als im Mai zutage.
Der größte Anstieg ist im Gebrauch Mündlicher Fragen zu verzeichnen. Gegenüber der ers- ten Pandemie-Phase stieg ihre monatliche Nutzung durchschnittlich um 30,2 Prozent an (151 zu 116) und im Vergleich zur Wahlperiode bis zum Ausbruch des Virus um 19,8 Prozent (151 zu 126). In der Gegenüberstellung zum Vorjahreszeitraum sind es durchschnittlich 8,6 Prozent im Monat (151 zu 139). Unabhängig davon, welcher Vergleichszeitraum herangezogen wird, zeigen diese Daten etwas sehr Wichtiges: vor der parlamentarischen Sommerpause wurde im Parlament überdurchschnittlich viel diskutiert – mehr als zu Beginn der Pandemie und mehr als vor Ausbruch des Coronavirus.
|
Kontrollinstrument |
Mai 2020 |
Juni 2020 |
Ø Nutzung pro Monat |
Ø Nutzung pro Monat im Vorjahreszeitraum Mai bis Juni 2019 |
Ø Nutzung pro Monat 19. WP1 |
| Kleine Anfragen | 186 | 340 | 263 | 233 | 250 |
| Schriftliche Fragen | 484 | 543 | 514 | 477 | 481 |
| Mündliche Fragen2 | 140 | 162 | 151 | 139 | 126 |
Quelle: Dokumentations- und Informationssystem (DIP) für parlamentarische Vorgänge
1 Berechnung des Durchschnittswertes ab dem Folgemonat der Regierungsbildung April 2018 bis Ende Januar 2020, exklusive der parlamentarischen Sommerpausen im Juli und August 2018 sowie 2019.
2 Umfassen alle im Plenum gestellten Fragen an die Bundesregierung.
Es spricht viel dafür, dass die Oppositionsfraktionen auch weiterhin in verstärktem Maße auf die ihnen zur Verfügung stehenden Kontrollinstrumente zurückgreifen werden. Schließlich sind zahlreiche Wege und Hilfsmaßnahmen zur Überwindung und Abfederung der aus der Corona-Pandemie entstehenden Folgen denkbar, weshalb künftige Regierungsvorlagen grundsätzlich viele Angriffspunkte für die Opposition bieten werden. Darüber hinaus rückt die Bundestagswahl 2021 immer näher, so dass die Oppositionsparteien aus wahltaktischen Gründen zur verstärkten Profilierung gezwungen werden.
Die statistischen Auswertungen zur Nutzung formaler Kontrollrechte in Corona-Zeiten zeigen minimale bis moderate Unterschiede im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und zur Wahlperiode bis zum Ausbruch des Virus. Während die am häufigsten genutzten Kontrollinstrumente (Kleine Anfragen, Schriftliche und Mündliche Fragen) in den ersten drei Monaten nach Ausbruch des Virus durchschnittlich seltener genutzt wurden[30], ist ihr Gebrauch für die Monate Mai und Juni dieses Jahres leicht überdurchschnittlich. Am deutlichsten traten die Unterschiede jeweils bei der Nutzung Mündlicher Fragen hervor, die in der ersten Pandemie-Phase am stärksten abnahm (bis zu durchschnittlich 27,6 Prozent pro Monat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und in der zweiten Phase am stärksten anstieg (bis zu 19,8 Prozent im Vergleich zum Monatsdurchschnitt in der 19. Wahlperiode bis zum Ausbruch des Virus). Letzteres deutet darauf hin, dass vor der parlamentarischen Sommerpause im Bundestag mehr debattiert wurde als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.
Für das Ansehen des Bundestags und insbesondere der parlamentarischen Opposition sind diese Beobachtungen von großer Bedeutung, da sie zeigen, dass die Nutzung formaler Regierungskontrolle in Corona-Zeiten relativ stabil war. Auf ihrer Grundlage muss weder eine „Superkonsensdemokratie“ gefürchtet werden noch ist bislang eine „Sternstunde der Opposition“ in Sicht. Vielmehr zeigten sich die Oppositionsfraktionen handlungsfähig in einer herausfordernden Zeit mit veränderten Arbeitsbedingungen. In ihrer Außenkommunikation können und sollten sie daher selbstbewusster auftreten.
Einen – eher unglücklichen − Vorstoß in diese Richtung unternahm Christian Lindner, der am April 2020 im Plenum das Ende der „große[n] Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements“[31] ankündigte. Für die Außenwirkung der Opposition war diese Aussage zwei- schneidig. Zwar verdeutlichte Lindner, dass die Regierung von diesem Zeitpunkt an mehr Kritik zu erwarten hätte, allerdings untermauerte er mit dem Begriff der „Einmütigkeit“ gleich- sam das medial tradierte Bild einer gelähmten Opposition zu Beginn der Corona-Pandemie. Dieses Bild entspricht in Zahlen nicht der Realität: Obwohl formale Kontrollrechte in der ersten Pandemie-Phase (Anfang Februar bis Ende April 2020) insgesamt seltener genutzt wurden, wurden jeden Monat durchschnittlich mehr als 100 Mündliche Fragen, 200 Kleine Anfragen und 400 Schriftliche Fragen an die Bundesregierung gerichtet (s. Tabelle 1). Selbst wenn man bedenkt, dass sich von diesen Fragen nicht alle auf die Corona-Schutzvorkehrungen der Bundesregierung oder deren Auswirkungen beziehen, lässt das Ausmaß an (Nach-)Fragen den Schluss auf ein einmütiges Vorgehen von Oppositions- und Mehrheitsfraktionen im Krisenmanagement nicht zu.
Zwar könnte argumentiert werden, dass Lindner auf eine Einmütigkeit in den generellen Leitlinien des Krisenmanagements anspielte, nur in diesem Fall hätte er dies erstens kommunizieren müssen und zweitens wäre zu hinterfragen, ob die Einmütigkeit nach dieser Auslegung tatsächlich vorbei wäre.
Zweifelsohne ist es für die Oppositionsparteien in Corona-Zeiten nicht leicht, sich medial Gehör zu verschaffen. Umso wichtiger ist es, dass sie Chancen der Außenkommunikation dafür nutzen, um klar und deutlich auf ihr zuverlässiges Gegenspiel parlamentarischer Kontrolle zu verweisen.
Neben häufig genutzten Kontrollinstrumenten wie Kleine Anfragen, Schriftliche und Mündliche Fragen, hätten die Oppositionsfraktionen auch die Möglichkeit Regierungsentscheidungen über Corona-Maßnahmen durch die Einberufung einer Enquête-Kommission oder eines Untersuchungsausschusses überprüfen zu lassen. Während erstere dazu dient, sich unter Einbezug externer und vor allem wissenschaftlicher Berater umfassende Informationen zum Zwecke künftiger Entscheidungen zu verschaffen, verfolgt letzterer die innerparlamentarische Aufklärung von Missständen und Skandalen von Regierung und Verwaltung, wofür Sachverständige und Zeugen vernommen werden können.[32]
Für Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, kommen beide Kontrollinstrumente in Betracht, wobei er einer Enquête-Kommission den Vorzug geben würde.[33] Die AfD verkündete am 30. Mai 2020 „die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung beantragen“ zu wollen.[34] Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke äußerten sich bislang noch nicht zur Einsetzung dieser Kontrollgremien.[35]
Das partielle Schweigen verwundert insofern nicht, als die Einberufung eines dieser Gremien für die Opposition aus zwei Gründen nicht sinnvoll erscheint: Erstens, gilt für beide Einrichtungen das „Prinzip der Diskontinuität“, was bedeutet, dass die Tätigkeiten einer Enquête-Kommission oder eines Untersuchungsausschusses bis zum Ende der laufenden Wahlperiode beendet werden müssen.[36] Da die 19. Wahlperiode in gut einem Jahr ihr reguläres Ende findet, bliebe demnach nicht viel Zeit, ein so umfassendes Thema wie das Regierungshandeln zu Beginn der Corona-Pandemie systematisch zu erschließen und zu bewerten.
Zweitens und gewichtiger ist, dass die Einberufung dieser Gremien den Oppositionsfraktionen kaum Möglichkeiten der Profilierung böten. Die Mitglieder einer Enquête-Kommission arbeiten sich umfassend in komplexe Themenfelder ein und leisten demnach pure Sacharbeit. Diese ist jedoch nicht öffentlichkeitswirksam und würde der Opposition deshalb nicht die Chance bieten, sich als Kontrollinstanz zu profilieren.
Ein Untersuchungsausschuss ist im Gegenzug öffentlichkeitswirksam, doch der Anlass für dessen Einsetzung erscheint erklärungsbedürftig. Welchen Missstand bzw. Skandal sollte ein Corona-Untersuchungsausschuss aufdecken? Was wäre (zumal vor dem Hintergrund der vergleichsweise niedrigen Sterblichkeitsrate in Deutschland) das konkrete Verdachtsmoment, das auf grobes Fehlverhalten der Bundesregierung schließen ließe? Der Output eines solchen Untersuchungsausschusses scheint vor diesem Hintergrund ungewiss. Dieser könnte sich – entgegen der genuinen Ausrichtung eines solchen Kontrollinstrumentes – sogar positiv für die Außenwirkung der Bundesregierung erweisen, sofern dieser kein selbstverschuldetes Versagen nachgewiesen werden könnte. In diesem Fall hätten die Oppositionsfraktionen durch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses der Regierung ungewollt eine Bühne geboten und stünden selbst geschwächt dar.
Damit die parlamentarische Opposition in Corona-Zeiten wieder stärker in ihrer Funktionswahrnehmung als Kontrolleur der Regierung wahrgenommen wird, muss sie demnach nicht mehr tun, sondern selbstbewusst darüber sprechen, was sie bereits getan hat. In Zeiten einer dominant auftretenden Exekutive würden die Oppositionsfraktionen dadurch nicht nur ihr eigenes, sondern auch das öffentliche Ansehen des Parlamentes stärken.
[1] Julia Merlot: Die unglückliche Reise von Patientin Null, Der Spiegel vom 16. Mai 2020, https://spiegel.de/wissenschaft/medizin/erster-corona-fall-in-deutschland-die-unglueckliche-reise-von- patientin-0-a-2096d364-dcd8-4ec8-98ca-7a8ca1d63524.
[2] Zur Bedeutung und Handlungsfähigkeit der Landesparlamente in Corona-Zeiten vgl. Corinna Koerber: Business as usual? The COVID-19 crisis in German state legislatures, März 2020, https://countingcountsblog. wordpress.com/ 2020/03/25/business-as-usual-the-covid-19-crisis-in-german-state-legislatures/.
[3] Die Monate Februar (erster Monat nach Ausbruch des neuartigen Coronavirus) bis Ende Juni 2020 (Beginn der parlamentarischen Sommerpause) stellen im weiteren Verlauf der Blickpunkt-Ausgabe den Untersuchungszeitraum für die Nutzung formaler Kontrollinstrumente durch die Oppositionsfraktionen dar. Aus diesem Grund finden – mit Ausnahme der ersten Eilverordnung des BMG − nur Vorkehrungen innerhalb dieser Periode Erwähnung.
[4] Henning Laux; Hartmut Rosa: Die beschleunigte Demokratie – Überlegungen zur Weltwirtschaftskrise, in: WSI-Mitteilungen 10/2009, https: //wsi.de/data/ wsimit_2009_10_laux.pdf.
[5] Das australische “Institute of Certified Management Accountants” (CMA) veröffentlichte Mitte April ein Ranking, welches das Regierungshandeln zu Beginn der Corona-Pandemie von knapp 100 Ländern verglich. Italien und Spanien stellten mit den Plätzen 93 und 95 die Schlusslichter dar. Deutschland rangierte hingegen auf Platz 16. CMA Australia: GRID Index: Tracking the Global Leadership Response in the Covid-19 Crisis, CMA-News vom 14. April 2020, https://www.cmawebline.org/ontarget/grid-index-tracking-the-global-leadership-response- in-the-covid-19-crisis/.
[6] Exemplarisch Susanne Götze: Im Ländervergleich liegt Deutschland sehr weit vorn, Der Spiegel vom 14. April 2020, https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ im-laender-vergleich-liegt-deutschland-sehr-weit- vorn-a-ebae15df-eca1-4daf-ae5b-8efcad11ee28.
[7] Exemplarisch David Vogel; Benedikt Hofer: Das Ausland erklärt Deutschland zum Corona-Vorbild, NZZ- Podcast vom 22. April 2020, https://www.nzz.ch/international/nzz-corona-podast-deutschland-das-corona- vorbild-ld.1552801.
[8] Zum Beispiel Florian Gathmann; Kevin Hagen: Alternativlos, Der Spiegel vom April 2020, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krisenkanzlerin-angela-merkel-alternativlos-a-9250cee9-ed1c-4bfa-b199- 4c4b96be3849; Katharina Schuler: Die Krisenkanzlerin ist zurück, Zeit online vom 11. März 2020, https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/angela-merkel-corona-pressekonferenz-jens-spahn oder Gathmann.
[9] Abweichend zu den Monaten März bis Mai wurde im Juni 2020 nicht nach dem „Krisenmanagement“, sondern allgemeiner nach der Zufriedenheit mit der Bundesregierung gefragt. Im Juli und August 2020 stieg die Zufriedenheit mit 63 bzw. 64 Prozent Zustimmung wieder leicht an. Vgl. ARD DeutschlandTREND von März bis August 2020, https://www.tagesschau.de/thema/ deutschlandtrend/.
[10] N.N.: Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID- 19-Krankheitsverlauf, Robert-Koch-Institut vom 13. Mai 2020, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html.
[11] Deutscher Bundestag: Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, Drucksache vom 25. März 2020, https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/ 181/1918126.pdf.
[12] Der Paragraf galt zunächst bis zum 30. September 2020 und wurde in der 176. Sitzung des Bundestages am September 2020 − gegen die Stimmen der AfD-Fraktion − bis zum Ende des Jahres verlängert.
[13] Johanna Sagmeister: Stresstest für das Parlament, zdfheute vom April 2020, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-bundestag-stresstest-100.html.
[14] Iris Marx: Auf verlorenem Posten, tagesschau vom 22. April 2020, https://tagesschau.de/inland/analyse-opposition-corona-krise-parteien-101.html.
[15] Stephan Bröchler: Sauerstoff für die Demokratie, taz vom 15. April 2020, https://taz.de/Opposition-in-Coronazeiten/!5675429/.
[16] Sven T. Siefken: Parlamentarische Kontrolle im Wandel. Theorie und Praxis des Deutschen Bundestages. Studien zum Parlamentarismus Band 31, Baden-Baden 2018, S. 227f.
[17] Jürgen von Oertzen: Das Expertenparlament. Abgeordnetenrollen in den Fachstrukturen bundesdeut- scher Parlamente. Studien zum Parlamentarismus, Band 3, Baden-Baden 2006, S. 281; Florian Meinel: Vertrauensfrage. Zur Krise des heutigen Parlamentarismus, München 2019, S. 168f.
[18] Sven T. Siefken: Parlamentarische Kontrolle im Wandel, S. 228 sowie Jürgen von Oertzen: Das Expertenparlament, S. 281.
[19] Jürgen von Oertzen unterscheidet drei Formen der Kontrollfunktion: Das Controlling durch die Mehrheitsfraktionen, die öffentliche oppositionelle Kontrolle sowie die nicht-öffentliche oppositionelle Kontrolle im Vgl. Jürgen von Oertzen: Das Expertenparlament, S. 281; zur nicht-öffentlichen oppositionellen Kontrolle vgl. zudem S. 236 – 238.
[20] Suzanne Schüttemeyer: Corona-Krise: Welche Folgen hat die Pandemie für Demokratien?, bpb vom 20. Mai 2020, https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/coronavirus/310202/demokratie.
[21] Wolfgang Zeh: Zum ausnahmslosen Primat des Parlaments, in: ZParl, Jg. (2020), H. 2, S. 469 – 473, S. 471.
[22] Zwar kann die Art und der Umfang informeller Kontrolltätigkeiten der Regierungsfraktionen nicht nachgezeichnet werden, allerdings steht − wie auch für die Oppositionsfraktionen − außer Frage, dass sie in Corona-Zeiten In einem Beitrag der Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich (SPD) und Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) hieß es zum Beispiel: „So manchen Regierungsentwurf haben die Koalitionsfraktionen mit eigenen Änderungsanträgen verändert, besser gemacht. Das ist unsere Aufgabe“. Vgl. Rolf Mützenich, Ralph Brinkhaus: Die neue Normalität auch für unsere Demokratie, Der Spiegel vom 28. Mai 2020, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/die-neue-normalitaet-auch-fuer-unsere-demokratie-a-8bb474b5-465c-4e84-bfb5-62fa-52509e60.
[23] Aufgrund der generell geringen Fallzahlen Großer Anfragen und Aktueller Stunden, können keine belastbaren Aussagen über das Nutzungsverhalten durch die Oppositionsfraktionen vor und während Corona-Zeiten getroffen In der 19. Wahlperiode gab es im Durchschnitt pro Monat eine Große Anfrage und vier Aktuelle Stunden.
[24] Raphael Markert im Interview mit Karl-Rudolf Korte: „Anwalt der Ungeduld“, SZ vom Mai 2020, https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-bundesregierung-opposition-1.4899513.
[25] WHO, Johns Hopkins University: Entwicklung der täglich neu gemeldeten Fallzahl des Coronavirus (CO- VID-19) in Deutschland seit Januar 2020, auf statista.com vom August 2020, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-taeglichen-fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland/#professional.
[26] Gudula Geuther: Schwierige Selbstbehauptung in Coronazeiten, deutschlandfunk.de vom 6. Mai 2020, https://deutschlandfunk.de/deutscher-bundestag-schwierige-selbstbehauptung-in.724.de.html?dram:article_id=476166.
[27] Zwar werden Schriftliche Fragen gemäß ihrer Bezeichnung schriftlich gestellt, allerdings erfolgt ihre Beantwortung mündlich, sofern sie für die Fragestunde formuliert wurden.
[28] Zum Vergleich: Der Monatsdurchschnitt in der WP liegt bei 250 Kleinen Anfragen, vgl. Tabelle 1.
[29] N.N.: 6. Mai 2020: Regeln zum Corona-Virus, vom 6. Mai 2020 auf bundeskanzlerin.de, https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/6-mai-2020-regeln-zum-corona-virus-1755252.
[30] Die Ausnahme bilden die Schriftlichen Anfragen im Vergleich zu ihrer Nutzung in der Wahlperiode bis zum Ausbruch des Coronavirus. Mit 488 zu 481 nahm ihr Gebrauch in dieser Gegenüberstellung minimal zu (s. Tabelle 1).
[31] Plenarprotokoll vom April 2020, 156. Sitzung, https://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19157.pdf, S. 19304.
[32] Der Untersuchungsausschuss gilt deshalb auch als „Kampfinstrument“ der Opposition, Sven Siefken: Parlamentarische Kontrolle im Wandel, S. 195f.
[33] Bayern 2 Nachrichten: FDP will Corona-Entscheidungen vom Parlament überprüfen lassen, br vom 4. Mai 2020, https://br.de/nachrichten/meldung/fdp-will-corona-entscheidungen-vom-parlament-ueberpruefen-lassen,3002c27c4.
[34] Richard Strobl; Florian Naumann; Alicia Greil: „Folgenreiche Fehlentscheidungen“: AfD fordert Untersuchungsausschuss
zur Corona-Politik der Regierung, Merkur.de vom 30. Mai 2020, https://www.merkur.de/politik/corona-deutschland-angela-merkel-lockerungen-regeln-soeder-spahn-news-covid-19-afd-untersuchungsausschuss-zr-13775102.html.
[35] Die Grünen forderten die Gründung eines „Pandemierates“, der allerdings ausschließlich als Beratungsgremium
der Bundesregierung fungieren soll. Vgl. N.N.: Grüne fordern Pandemierat, Antrag vom 1. Juli 2020,
https://www.bundestag.de/presse /hib/703884-703884.
[36] Enquête-Kommissionen können zwar in einer darauffolgenden Wahlperiode neu beantragt werden, allerdings
muss eine Aussprache des Bundestages über deren Bericht in der Wahlperiode ihrer Einsetzung erfolgen.
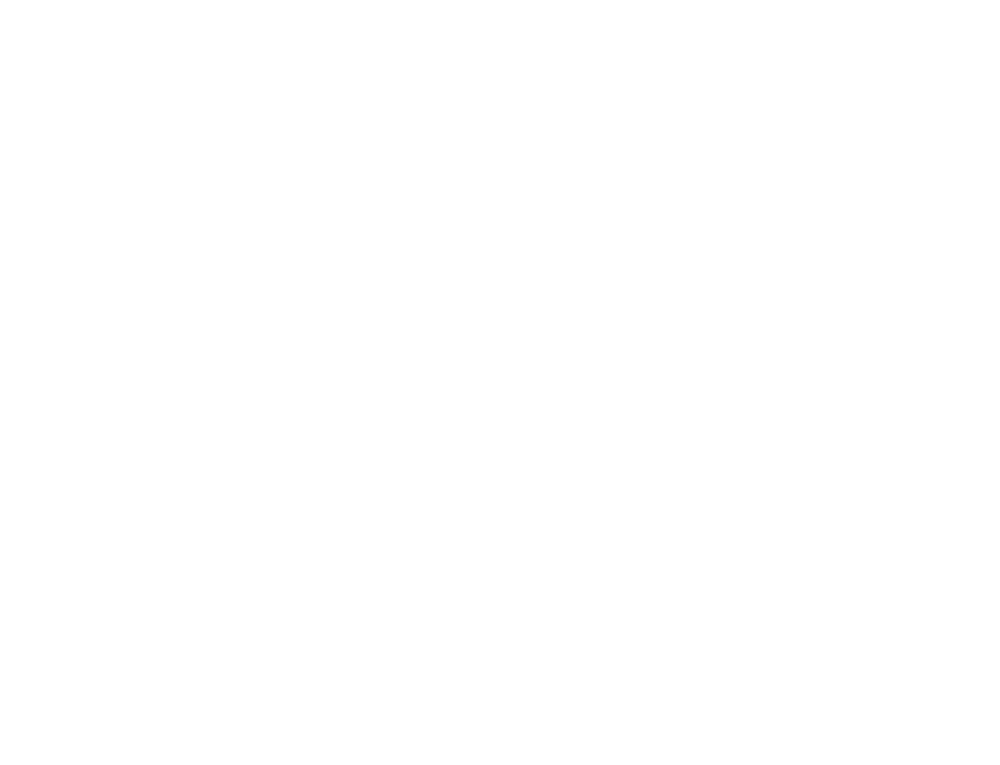
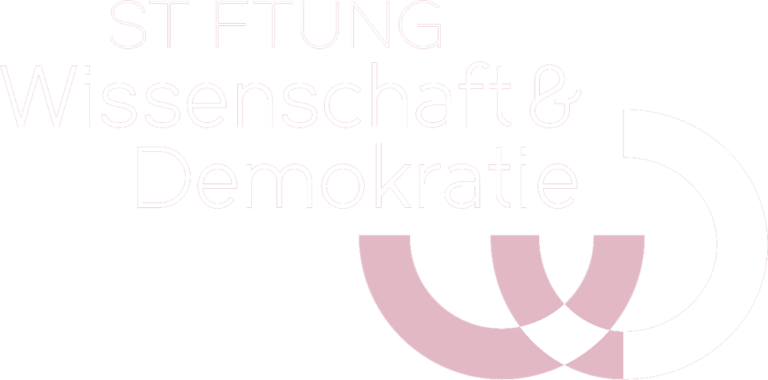
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.