von Benjamin Höhne und Svenja Samstag
DOI: 10.36206/BP2020.02
Im Bundestagswahlkampf 2021 hebt sich die Kanzlerkandidatin der Bündnisgrünen, Annalena Baerbock, durch ein Merkmal hervor – ihr Geschlecht. Dass dies so ist, spricht für die ungebrochene Wirkmächtigkeit tradierter Geschlechterrollen. Wie die Frage der Geschlechtergerechtigkeit in Parlamenten zukünftig beantwortet werden kann, untersucht dieser Blickpunkt. Nachdem Paritätsgesetze vorerst gescheitert sind, braucht es andere Ansätze. Der Ball liegt wieder bei den politischen Parteien. Das innerparteiliche Problembewusstsein ist weithin vorhanden. Ein Ausgleich der Geschlechter auf den Listen findet mit Ausnahme der AfD in jeder Bundestagspartei große Zustimmung. An Umsetzungsmöglichkeiten, angefangen bei der freiwilligen Frauenquote, mangelt es nicht. Doch auch die Wählerinnen und Wähler können beim Thema parlamentarische Repräsentation von Frauen Gewicht entfalten. Sie müssten es bei der kommenden Bundestagswahl im September nur in die Waagschale werfen.
Das Wichtigste in Kürze:
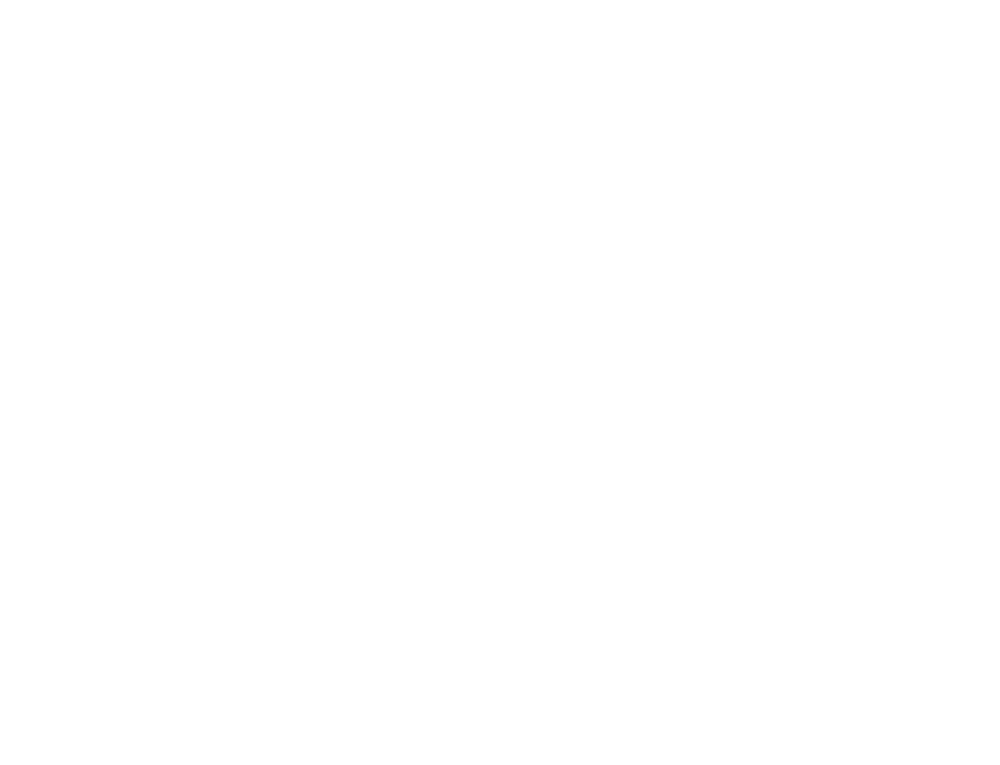
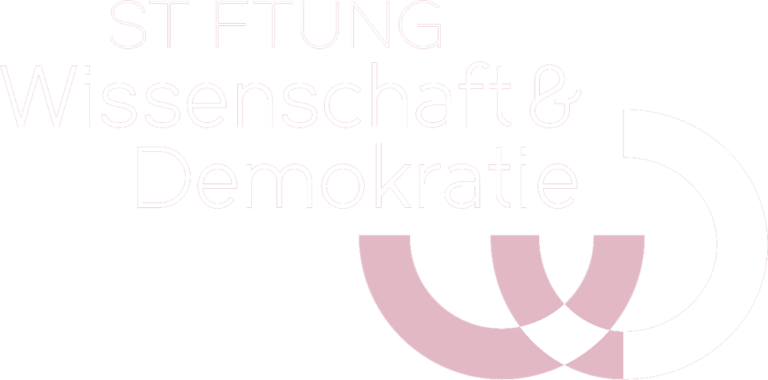
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.